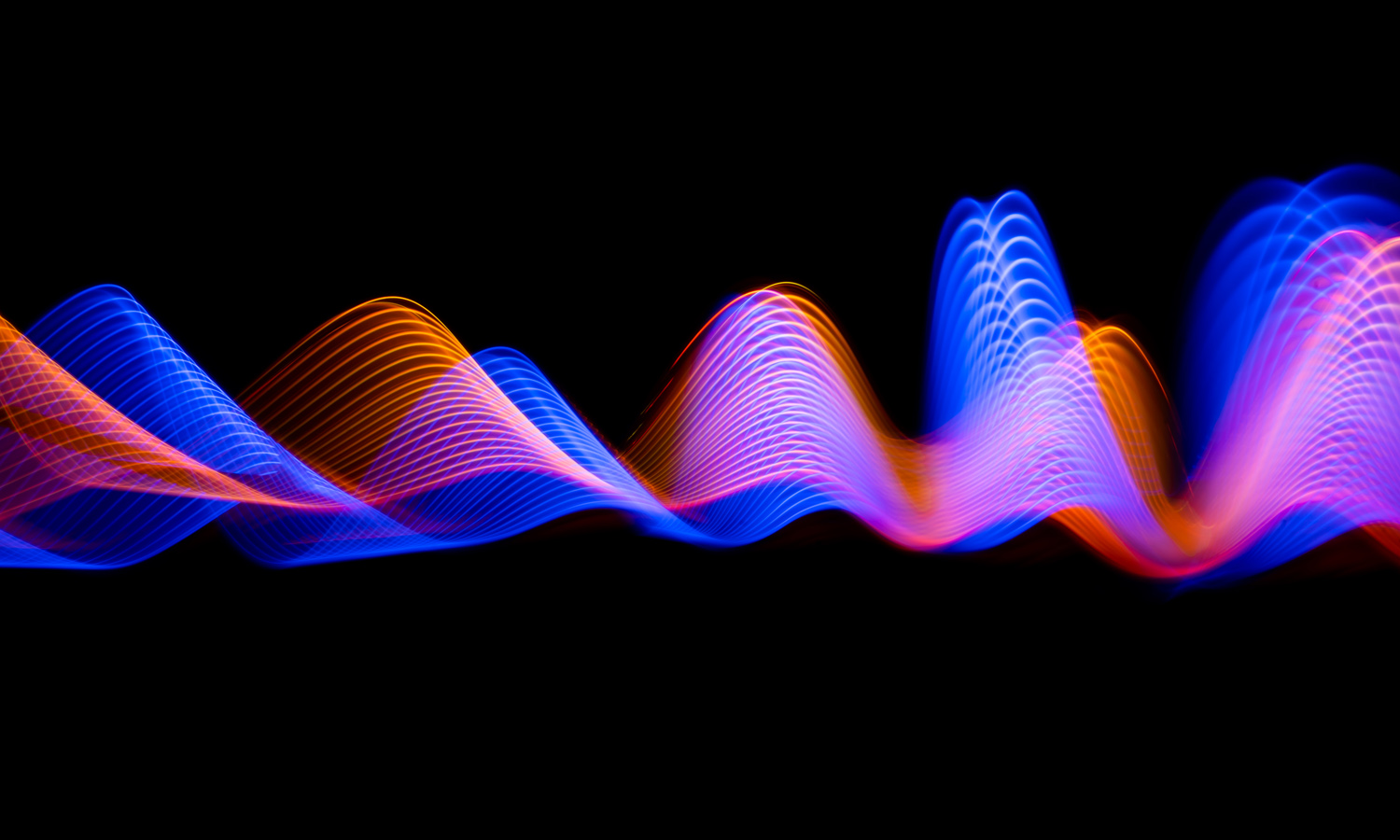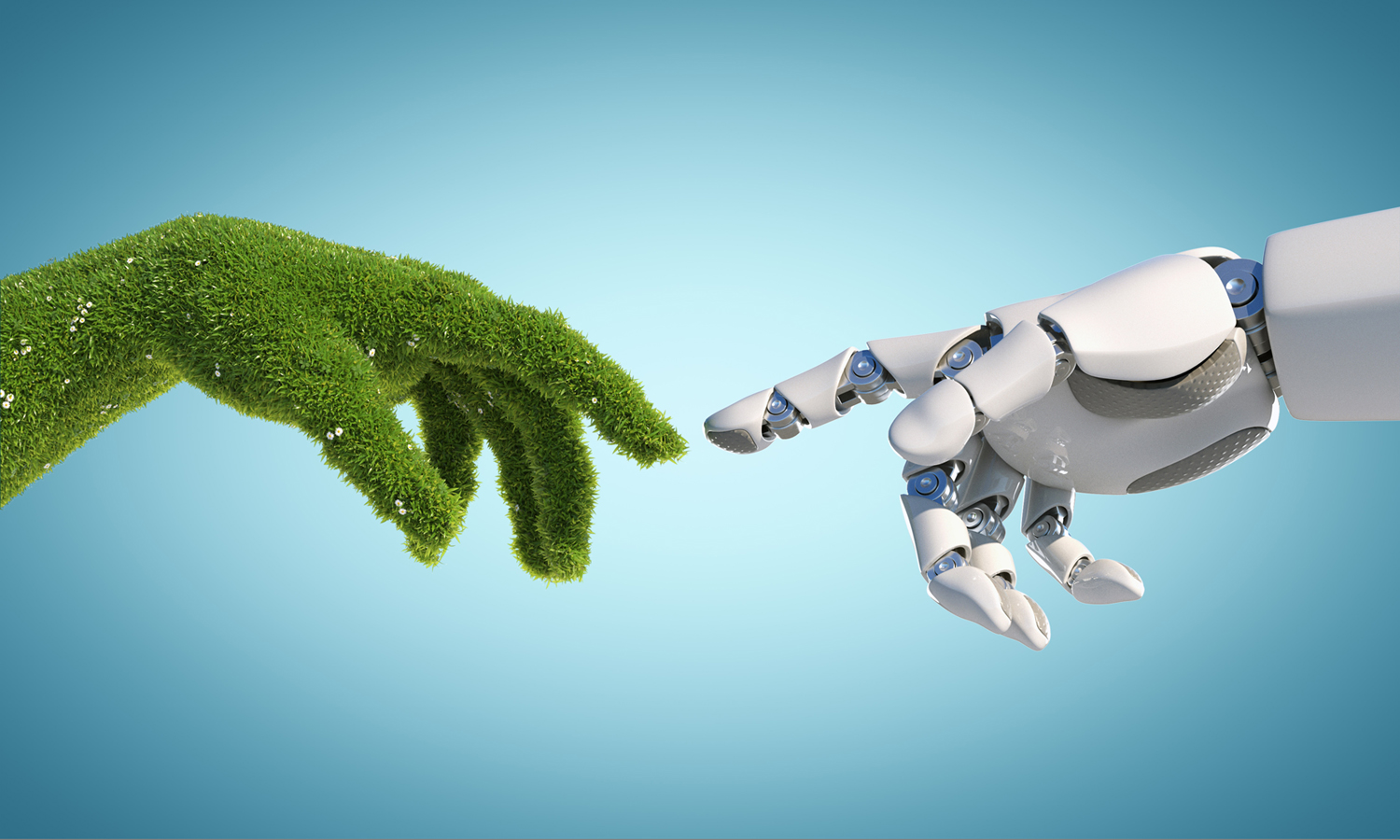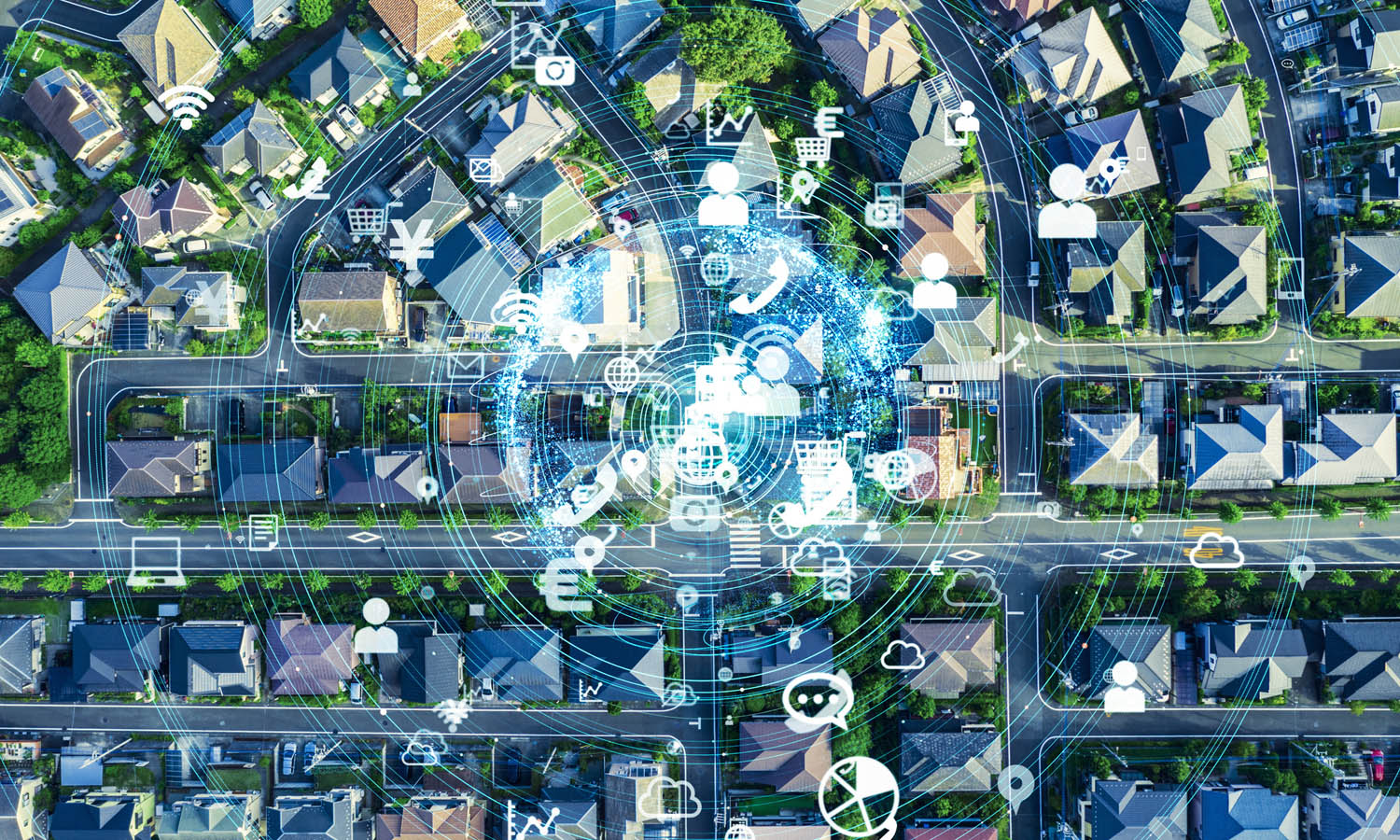Wer mich kennt, weiß, dass ich zwei Leidenschaften habe. Die eine ist das Internet. Von der anderen komme ich gerade zurück.
Ich war nun schon einige Male in Nepal. Was mich ursprünglich dort hingezogen hat, ist klar: Die Landschaft. Oder genauer gesagt, die Berge. Ich mag die Alpen, ich mag auch die Rockies, und die schroffen Gipfel Patagoniens, die ich nur mit rauem Wind kenne, mag ich auch. Aber der Himalaya, davon durfte ich mich erstmalig 2008 überzeugen, ist doch noch einmal eine ganz andere Nummer.
Seither war ich noch fünf Mal in Nepal. Und klar, die Berge waren immer offensichtlich und überall sehr präsent. Aber woran ich zwischen meinen Reisen immer öfter dachte und was mit den Jahren immer wichtiger wurde, waren die Menschen.
Bei meiner jüngsten Reise nun spielte neben den Bergen und den Menschen, die mit ihnen leben, noch meine Leidenschaft Internet eine Rolle. Mit der Abdeckung im Himalaya ist das so eine Sache, weshalb nicht nur die, die ganz hoch hinauf wollen, gerne per Satellit verbunden bleiben. Aber auch in den Siedlungen ist das Internet keine Selbstverständlichkeit.
Umso mehr hat es mich gefreut, dass ich mir in den malerischen Bergdörfern Kumjung und Khunde ein faszinierendes Projekt der Internet Society (ISOC) anschauen durfte. Das Projekt gehört zur „Connecting the Unconnected“ Initiative und bringt das Netz über eine Glasfaser-Anbindung von der Relaisstation auf dem Berg oberhalb des Dorfes direkt in eine Schule. Ein unscheinbares Kästchen markiert den Endpunkt dieser technischen Meisterleistung.
Die Verbindung von 10 Mbit/Sekunde ist nicht gerade die schnellste, das wissen auch die Schülerinnen und Schüler, die dort nun Netzzugang haben – aber es ist ein Anfang und für die Region ein Leuchtturm. Der Zugang ist für alle Klassen offen, vermittelt werden neben allgemeinen Grundlagen auch schon fachspezifische Inhalte.
Wäre doch schön, wenn es bei meinem nächsten Besuch schon mit der Gigabit-Leitung klappen würde, von der manche jetzt schon träumen und auch die Clients könnten noch das ein oder andere Upgrade erfahren. Aber ein Anfang ist gemacht und dem wohnt bekanntlich oft ein ganz besonderer Zauber inne.
ISOC Project Nepal
(english version)